Bundesverfassungsgericht: Online-Durchsuchung in Bayern teils rechtswidrig
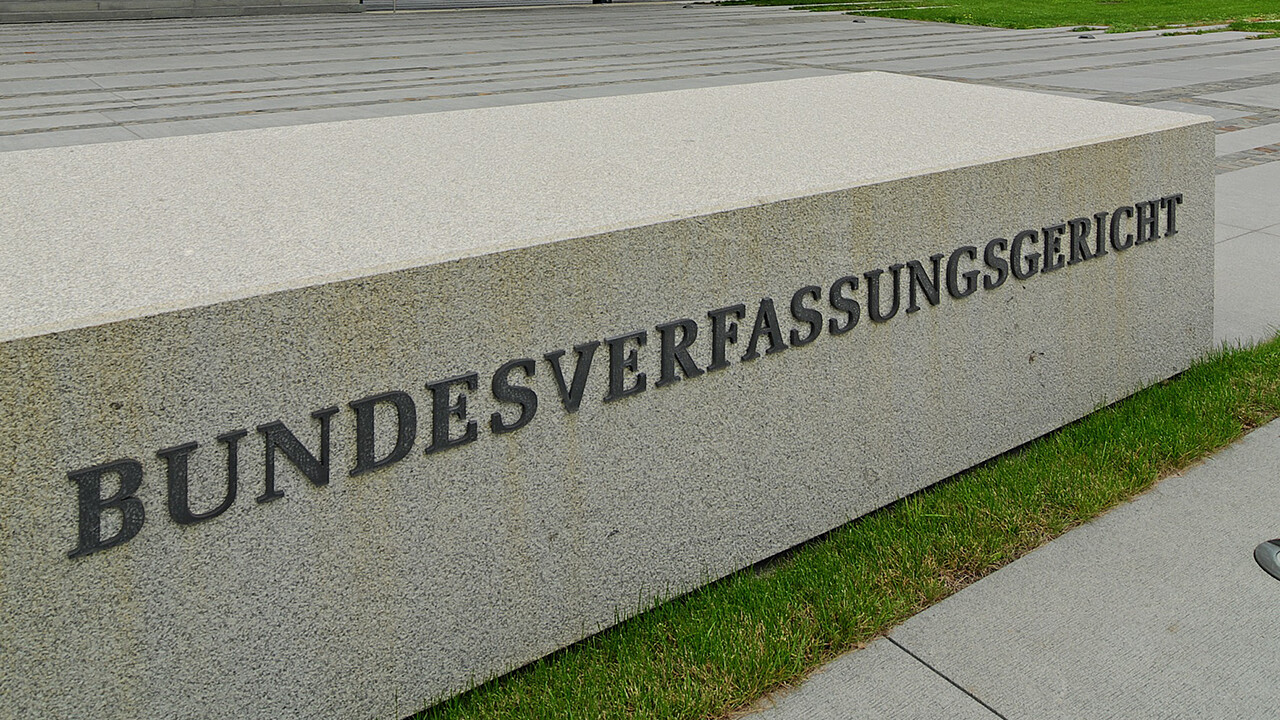
Teile des Bayrischen Verfassungsschutzgesetzes sind rechtswidrig. Das Bundesverfassungsgericht ist in seinem nun getroffenen Urteil der Auffassung, dass die den Sicherheitsorganen rechtlich gegebenen Befugnisse gegen die bürgerlichen Grundrechte verstoßen. Das gilt besonders für die Online-Durchsuchung und Weitergabe von Daten.
Zu weit gefasste Befugnisse
Damit ist der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts in seinem nun erfolgten Urteil den Argumenten der drei Kläger in weiten Teilen gefolgt. Die Kläger sind Mitglieder einer Organisation, die im bayerischen Verfassungsschutzbericht als „linksextremistisch beeinflusst“ bezeichnet wird. Unterstützt wurden die Personen in ihrer Verfassungsbeschwerde von der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF), die mit der Klage ähnliche Gesetze in anderen Bundesländern verhindern wollte. Da eine Verfassungsbeschwerde nur von jemanden erhoben werden kann, der selbst von der Einschränkung seiner Grundrechte betroffen ist, konnte die GFF in diesem Fall nur unterstützend tätig werden.
Mit dem Urteile wurde eine Reihe von Gesetzen des 2016 neu gefassten und grundlegend neu strukturierten Bayerischen Verfassungsschutzgesetz für nichtig erklärt. In Folge dessen besaß der Verfassungsschutz in Bayern über die Jahre hinweg Befugnisse, die er laut dem nun veröffentlichten, 150 Seiten umfassenden Urteil nicht hätte innehaben dürfen.
Die Richter in Karlsruhe störten sich vor allem an den ihrer Meinung nach zu großen Befugnissen der bayerischen Verfassungsschützer, die diese bei Online-Durchsuchungen, bei der Ortung von Mobiltelefonen, bei der Wohnraumüberwachung und beim Einsatz von verdeckten Mitarbeitern ausüben durften. Gleichzeiten monierte das Gericht, dass diese Möglichkeiten zu schnell herangezogen würden, obwohl sie dem Gesetz nach das letzte Mittel darstellen und nur dann zum Einsatz kommen sollten, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft wären.
So wurde im nun schriftlich veröffentlichten Urteil zunächst die Wohnraumüberwachung einer genaueren Prüfung unterzogen – und als verfassungswidrig eingestuft. Das Gericht sieht zwar die Eingriffsvoraussetzungen als hinreichend begründet, kann in dem Gesetz jedoch nicht das Ziel einer Gefahrenabwehr erkennen, weil die erforderliche Regelung zur Subsidiarität gegenüber Maßnahmen zur Gefahrenabwehr der jeweiligen Behörden fehlen würden. Das bedeutet letztendlich, dass der Geheimdienst nur dann aktiv werden darf, wenn darunter agierende Behörden diese Aufgabe in ihrem Maße oder in der gegebenen Zeit nicht nachkommen können. Damit vollzog das Gericht auch eine klare Trennung zwischen den polizeilichen Behörden und dem Geheimdienst.
Immer wieder zu niedrige Hürden
Dies war aber nicht die einzige Kritik, welche die Verfassungsrichter an dem Gesetz übten. So sahen diese bei der Online-Durchsuchung den Kernbereichsschutz zwar für die Erhebungsebene erfüllt, nicht aber für die Auswertungsebene. Auch wurde kritisiert, dass die Hürden für entsprechende Grundrechtseingriffe zu niedrig angesetzt seien und dass eine Vorabprüfung durch eine unabhängige Stelle fehlen würde.
Laut dem Gericht besitze der Verfassungsschutz bei seiner primären Aufgabe der Beobachtung und Vorfeldaufklärung „modifizierte Eingriffsschwellen“, was größere Spielräume erlauben würde. Diese sind aber ebenso an das Grundrecht und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gebunden. „Maßnahmen, die zu einer weitestgehenden Erfassung der Persönlichkeit führen können, unterliegen denselben Verhältnismäßigkeitsanforderungen wie polizeiliche Überwachungsmaßnahmen“, so das Gericht in seiner schriftlichen Begründung.
Die Übermittlung von durch die Arbeit von Polizeibehörden und dem Geheimdienst gewonnenen Informationen ins europäische Ausland oder an nicht-öffentliche Stellen sah das Bundesverfassungsgericht dagegen nicht als problematisch an. Voraussetzung hier sei nur, dass die Daten ausschließlich zu Analysezwecke verwendet werden dürfen. Anders bewerteten die Richter dagegen das Fehlen von eindeutigen Regelungen bezüglich der Übermittlungsvoraussetzungen, da die Weiterleitung einen weiteren Grundrechtseingriff darstellt. Auch hier sah das Gericht die Hürden als zu niedrig angesetzt, da nach aktuellem Gesetz Daten auch für kleinere Verstöße übermittelt werden dürfen. Gleiches urteilte der Erste Senat in Bezug auf die Regelung zum Einsatz von Verdeckten Mitarbeitern nach Art. 18 Abs. 1 BayVSG, welches gegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung verstoße. Auch hier bestehen keinerlei hinreichenden Eingriffsschwellen.
Auf die Auskünfte der Telekommunikationsdienstleistern müssen die Bayerischen Verfassungsschützer in Zukunft verzichten, diese seien nach Auffassung des Gerichtes laut Bundesrecht nicht zur Übermittlung an das Landesamt verpflichtet. Ebenso verstoße die Abrufregelung gegen das Gebot der Normenklarheit.
Signal über Landesgrenzen hinaus
Durch das jetzt verkündete Urteil steht der Landesregierung in Bayern viel Arbeit bevor, denn in seiner jetzigen Umsetzung darf das Bayerische Verfassungsschutzgesetz nur noch bis zum 23. Juli 2023 in Kraft bleiben – und dass auch nur in eingeschränkter Form. Gleichzeitig ist das nun gesprochene Urteil ein Fingerzeig für andere Landesregierungen, welche ein Verfassungsschutzgesetz nach dem Vorbild Bayerns etablieren wollten.
Gegen das Gesetz hatte bereits 2017 ebenso die Landtagsfraktion der Grünen Klage beim Bayerischen Verfassungsgerichtshof eingereicht. In diesem Verfahren ist es noch nicht zu einem Urteil gekommen.
