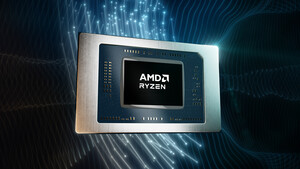Wie wir alle wissen, werden Prozessoren auf ihre Güte geprüft - nicht jeder Wafer entspricht der Qualität, um die architektonisch vorgesehene Leistung zu erreichen - um anschließend festzulegen, innerhalb welcher Spannungen und Frequenzen der geprüfte Protagonist innerhalb einer moderaten Fehlerquote arbeiten kann.
Die Spannung wird vom Board generiert, die Prozessorfrequenz wird aus Bustakt und dem Multiplikator erzeugt
Diese elektronische Multiplikation wird in der Regel über
PLLs realisiert.
In CPUs älterer Generationen waren die fest verdrahtet, später dann immerhin über externe Elemente ansprechbar; die berühmten L-Brücken bei alten Athlons. Sinn dabei war, den maximal zulassigen Multiplikator nach dem Test einstellen zu können.
AMD Besitzer mit Fingerspitzengefühl konnten diese Brücken öffnen oder schließen:
Grobmotoriker dagegen haben einfach ein Stück wertloses Silizium erzeugt:
"Stolze" Pentiumbesitzer haben zu dieser Zeit generell in die Röhre gekuckt, weil Intel die PLLs fest innerhalb des Prozessor verdratet und somit den Multi unumgehbar festgelegt hatte.
Im Laufe derzeit wurde das System geändert, sodass die Beschaltung der PLLs logisch festgehalten wurde.
Das hat zum einem den Vorteil, dass nach dem Test zur CPU Güte der Prozessor nicht mehr physisch bearbeitet werden musste, zum anderen öffnete es einen neuen Option den Weg:
den Prozessor, je nach Auslastung, unterschiedlich zu takten.
Dafür werden in spezielle Register die jeweiligen Informationen für die gewünschte Beschaltung der PLLs geschrieben.
In analog dazu existierende Register werden Informationen geschrieben, welche Spannung aktuell für den Prozessor benötigt wird, diese dann vom Motherboard interpretiert und umgesetzt.
Die Daten dieser möglichen Registerinhalte werden im Prozessor vorgehalten, um im bestimmten Lastfall (P-State) in die Register geschrieben zu werden.
Diese Daten können zusammen mit anderen Informationen (Prozessorname, Code Name, Package, freigeschaltete Cores) durchaus als Firmware bezeichnet werden.
Da der Prozessor nach der Prüfung nicht mehr "angefasst" wird, kann die Festlegung von max. Frequenz / Multi eben nur durch ein Speichern des Datensets (resp. Firmware) erfolgen.
Dabei kann die Firmware so gestaltet sein, dass zwar ein Multi vorgegeben, empfohlen ist, dieser aber dennoch auf eigene Gefahr frei gewählt werden kann (bei AMD kann man z.B. mit entsprechender Software direkt die Register beschreiben).
Andererseits kann das Verändern nach oben (nach unten soll ja weiterhin möglich sein, wg. z.B: QnC) blockiert sein.
Aber wo eine Firmware einmal hingeschrieben wurde, kann heutzutage oft noch ein weiteres mal hingeschrieben werden.
Man muss nur rausfinden, wie.
Hat man das, ermöglicht es einem z.B. das Freischalten ehemals gesperrter Kerne oder auch den freien Zugriff auf die Register der PLL Beschaltung und somit den Multiplikator.
Meistens scheitert es daran, dass man nicht weiß, wie man die Firmware ein weiteres mal schreibt oder aber der Bereich für die Firmware wurde doch schon zu oft neu beschrieben, z.B. weil nach dem ersten Test falsche Informationen abgelegt wurden.
Die Antwort in Kurzfassung: bei den meisten Mainstreamprozessoren ist der maximal verfügbare Multiplikator in einer "Firmware" gespeichert, die wenigsten sind heutzutage noch fest verdrahtet oder extern beschaltet.