Computerspielsucht: DAK hält 450.000 Jugendliche für „Risiko-Gamer“
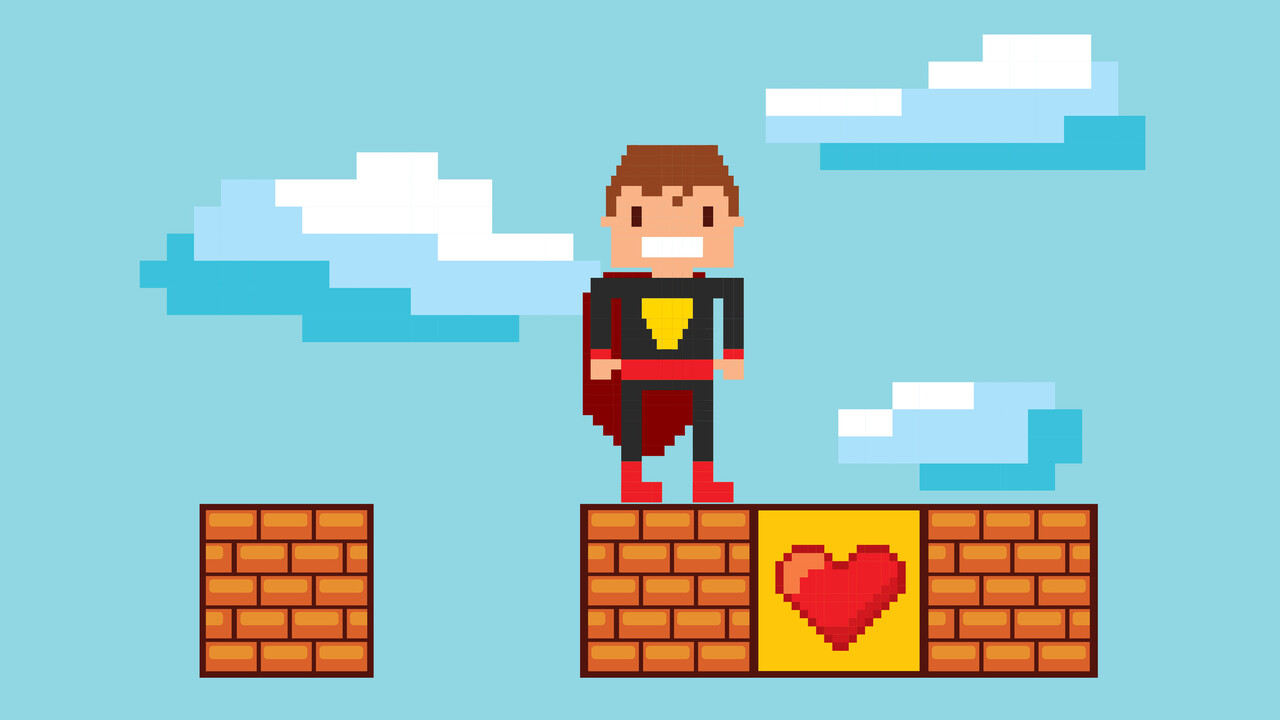
Die DAK-Krankenkasse hat mit dem Deutschen Zentrum für Suchtfragen das Spielverhalten von Jugendlichen untersucht. Hochgerechnet 465.000 oder 15,4 Prozent aller Jugendlichen weisen demnach ein „riskantes oder pathologisches Spielverhalten im Sinne einer Gaming-Sucht“ auf. Grund ist unter anderem das Spieldesign.
Befragt wurden in der repräsentativen Studie 1.000 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren. Sie spielen, zeigen die Ergebnisse, zum Spaß, zum Abschalten und um Zeit zu vertreiben. Mädchen bevorzugen dabei Sims und Minecraft, Jungen die Publisher-Geldesel Fortnite und FIFA, wobei insgesamt knapp 90 Prozent aller Jungen und gut 50 Prozent der Mädchen spielen – das Medium ist also in der Gesellschaft angekommen.
Das Medium ist aber nicht nur etabliert, sondern wird von 15,4 Prozent der Jugendlichen auch problematisch genutzt. Dies gilt überwiegend für Jungen: Sie machen 79 Prozent der Risikogruppe aus. Auf 3,3 Prozent der derart klassifizierten Spieler treffen zudem Kriterien einer Computerspielabhängigkeit zu (pdf). Sie litten unter Entzugserscheinungen, Kontrollverlusten oder Gefährdungen.
Auswirkungen hat das riskante Spielverhalten aber auch dann, wenn es noch nicht als volle Abhängigkeit klassifiziert werden kann. Die „Risiko-Gamer“ fehlen etwa dreimal häufiger in der Schule als normale Spieler und hätten „mehr emotionale oder Verhaltensprobleme“, weitere Unterschiede betreffen Konzentration, motorische Unruhe und aggressives Verhalten.
Auch die Ausgaben unterscheiden sich. Die Risikogruppe gab innerhalb eines halben Jahres mehr Geld für die Anschaffung von Spielen (~135 zu ~82 Euro) sowie insbesondere für Extras (~94 zu 39 Euro) aus. Im Schnitt lagen die Ausgaben bei 110 Euro, der Spitzenwert erreichte allerdings fast 1.000 Euro. Ausgegeben wurde das Geld für In-Game-Währungen und kosmetische Extras, nur sechs Prozent der Spieler erwarben zumindest nach eigenen Angaben Loot-Boxen. Spielzeit und die Höhe der Ausgaben hängen laut Studie zusammen.
Dass Spieler mögliche Abhängigkeiten beziehungsweise ein problematisches Spielverhalten entwickeln, liegt laut dem Deutschen Zentrums für Suchtfragen durch Spielelemente, die diese Entwicklung fördern. Genannt werden:
DZfS
- Die virtuellen Welten verändern sich ständig. Es werden neue Spielerlebnisse ohne endgültiges Ziel angeboten.
- Games gehen auf Bedürfnisse und Wünsche der Spieler ein und berücksichtigen persönliche Fähigkeiten.
- Soziale Zugehörigkeit: Ein Teamverbund ermöglicht schnelle Spielfortschritte und schafft Wertschätzung und Anerkennung.
- Belohnungen für hohes Spielengagement der Gamer.
- Loot-Boxen: Diese Überraschungskisten gibt es für erfolgreiches Spiel oder gegen Geld. Nutzer werden so an die suchtgefährdenden Mechanismen des klassischen Glücksspiels herangeführt. In Belgien und den Niederlanden sind Loot-Boxen bereits verboten.
- Virtuelle Währung: Geld intensiviert das Spielerlebnis. Bestimmte Funktionen sind nur im Tausch gegen Geld zu erlangen (In-Game-Käufe). Es werden virtuelle Währungen wie z.B. „V-Bucks“ eingesetzt, wodurch der Überblick der Ausgaben erschwert wird.
Lösung: Aufklärung und Verbote
Von der DAK werden auf Basis dieser Erkenntnisse zwei Maßnahmen gefordert. Zunächst soll die Aufklärung über Risiken und Anzeichen problematischen Spielverhaltens verstärkt werden. Außerdem werden nach belgischem Vorbild ein Verbot der Beuteboxen sowie Warnhinweise, die auf das Überschreiten von vorgegebenen Spielzeiten hinweisen, gefordert.
Auf die Effektivität des auf Verkäufe und Spielzeiten abzielenden Gamedesigns weisen seit längerer Zeit die steigenden Gewinne und Umsätze von Publishern hin. Diese werden immer stärker mit Mikrotransaktionen und immer weniger mit dem Verkauf der eigentlichen Spiele gemacht. Beuteboxen sind zuletzt immer stärker in das Visier der Behörden geraten, sie werden zunehmend kritisch gesehen.


